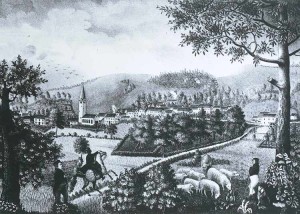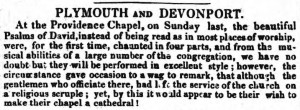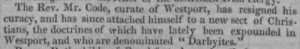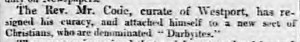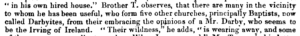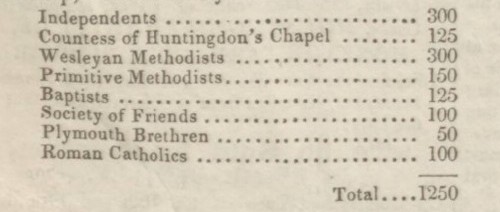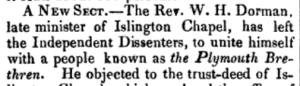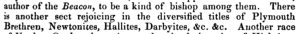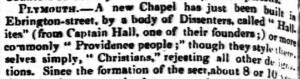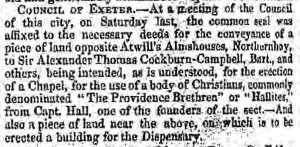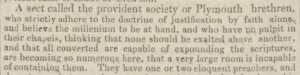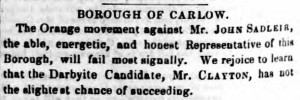Frederick John William Lambart, der 8. Earl of Cavan, gehört ähnlich wie George Frederic Trench oder Henry Heath zu den hierzulande weniger bekannten „Chief Men“ der britisch-irischen Offenen Brüder. Er wurde heute vor 200 Jahren in Fawley (Hampshire) an der Südküste Englands geboren.
Lambarts Eltern waren George Lambart, Viscount Kilcoursie, der älteste überlebende Sohn des 7. Earl of Cavan, und seine Frau Sarah geb. Coppin. Beide starben früh – die Mutter 1823 und der Vater 1828 –, sodass Frederick bereits mit 13 Jahren Vollwaise war. Von 1829 bis 1833 besuchte er die bekannte Eliteschule in Eton, anschließend trat er ins 7. Dragonerregiment ein, das damals in Irland stationiert war. In Dublin besorgte er sich 1835 zum ersten Mal in seinem Leben eine Bibel.
1837 starb Fredericks Großvater Richard Lambart, der 7. Earl of Cavan. Da sein Sohn George, der eigentliche Anwärter auf den Titel des 8. Earl,1 ebenfalls schon verstorben war, ging der Titel direkt auf den knapp 22-jährigen Enkel Frederick über. Acht Monate später heiratete dieser in London die 21-jährige Caroline Augusta Littleton, eine Tochter des Politikers Edward John Littleton, 1. Baron Hatherton.2 Die beiden bekamen mindestens acht Kinder, von denen allerdings drei früh starben.3
Von 1839 bis 1844 hielten sich die Cavans vorwiegend auf dem europäischen Kontinent auf; einen Winter verbrachten sie in Frankfurt, einen Sommer in Bad Ems, danach zwei Jahre in München. Hier begann Lord Cavan, angeregt u.a. durch einen Brief seines Schwagers Charles Evelyn Pierrepont, Viscount Newark, mit einem systematischen Studium der Bibel. Zurück in England, schloss er sich den „Brüdern“ an, denen er bis zu seinem Lebensende verbunden blieb (nach 1848 den Offenen Brüdern). 1846 war er an der Gründung der Evangelischen Allianz beteiligt.
Ab 1864 sah sich Lord Cavan zunehmend in den Predigt- und Evangelisationsdienst berufen. Sein Biograf in Chief Men among the Brethren beschreibt seinen Predigtstil wie folgt:
Quiet in manner, with little action, and no attempt to seem a striking preacher, with his Bible in one hand and his eyeglass in the other, confidence in the Lord gave power to what he spoke. “I am,” he would say, “only a plain man; but I speak what I know.” He might begin without giving the impression of much power; but after a little, with his heart yearning over those he addressed, his tender manner became full of energy, his tones earnest, and his words very solemn. The true end of preaching was reached; his hearers felt that, whether for life of death, Lord Cavan’ s testimony was a message from God.4
1866 lud Lord Cavan, der seit 1860 in Weston-super-Mare wohnte, den Evangelisten Lord Radstock (1833–1913) zum Predigen dorthin ein. Es entstand eine kleine Erweckung, bei der u.a. Friedrich Wilhelm Baedeker (1823–1906) zum Glauben kam. Besonders am Herzen lag dem Ehepaar Cavan auch der Nachbarort Milton (heute ein Stadtteil von Weston); hier kümmerten sie sich finanziell um die Armen, und Lord Cavan ließ einen Missionssaal errichten, in dem er selbst oft predigte. Karitativ engagierte er sich ferner auf der irischen Insel Achill, wo er ein Anwesen besaß.
Am 16. Dezember 1887, genau zwei Wochen vor seinem 72. Geburtstag, erlag Lord Cavan in seinem Haus in Weston-super-Mare einer Bronchitis. Über seine Beerdigung am 22. Dezember berichtete der Taunton Courier:
The mortal remains of the late Lord Cavan were interred in the Weston-super-Mare cemetery on Thursday, in the presence of a large concourse of spectators. At 11.30 a.m a short service was held in the Lodge – the residence of deceased – at the conclusion of which the cortège was formed in the following order: – First came the coffin – which was of polished oak with handsome bras [sic] fittings – on which were deposited several handsome floral tributes. Then followed, on foot, the subjoined mourners: Lord Kilcoursie, M.P. (eldest son), Col. the Hon. Oliver Lambert (brother of deceased), Capt. the Hon. A. Lambert (youngest son), Col. Slanden (son.in-law [sic]), the Hon. R. Lambert (Lord Kilcoursie’s eldest son), Col. the Hon. E. Littleton and the Hon. W. Littleton (nephews of the Countess Cavan), Mr Bowens, London (nephew of Lord Cavan), Capt. Broughton (Ampthill), and Mr Nisbet solicitor, London). Next in the procession came several ladies and the servants of the Lodge, all carrying choice wreaths, and these were followed by a large number of the clergy and gentlemen of the town and neighbourhood. In the cemetery chapel a short service was held, in which Mr T. Newbery and Mr A. Rainey took part. Subsequently, at the graveside, Dr Baedeker, Mr Newbury, and the Rev. Colin Campbell (vicar of Christ church), concluded the service, among the spectators of the mournful ceremony being the tenantry of the deceased from Glastonbury and Cannington, Rev. Preb, [sic] Stephenson (Lympsham), Rev. W. H. Turner (Banwell), Mr W. Hurman [Mayor of Bridgwa er [sic]), Mr F. J. Thomson (Bridgwater), Mr B. P. Thomas (Clifton), Capt. West (Clifton), Bev. [sic] J. Ormiston (Bristol), &c. The site of the interment is alongside the graves of three of deceased’s sons, all of whom died in their youth[.] As a mark of respect to the memory of deceased, the prinioal [sic] places of business throughout the town were partially closed during the hour of interment; the Uuion [sic] Jack was flcated [sic] at half-mast on the tower of the parish church, and a muffled peal was rung on the bells of the same parochial edifice.5
Das Lebensbild Lord Cavans aus Chief Men among the Brethren ist online zugänglich, enthält allerdings mehr fromme Redewendungen als konkrete Fakten; informativer ist der Artikel in der englischsprachigen Wikipedia.