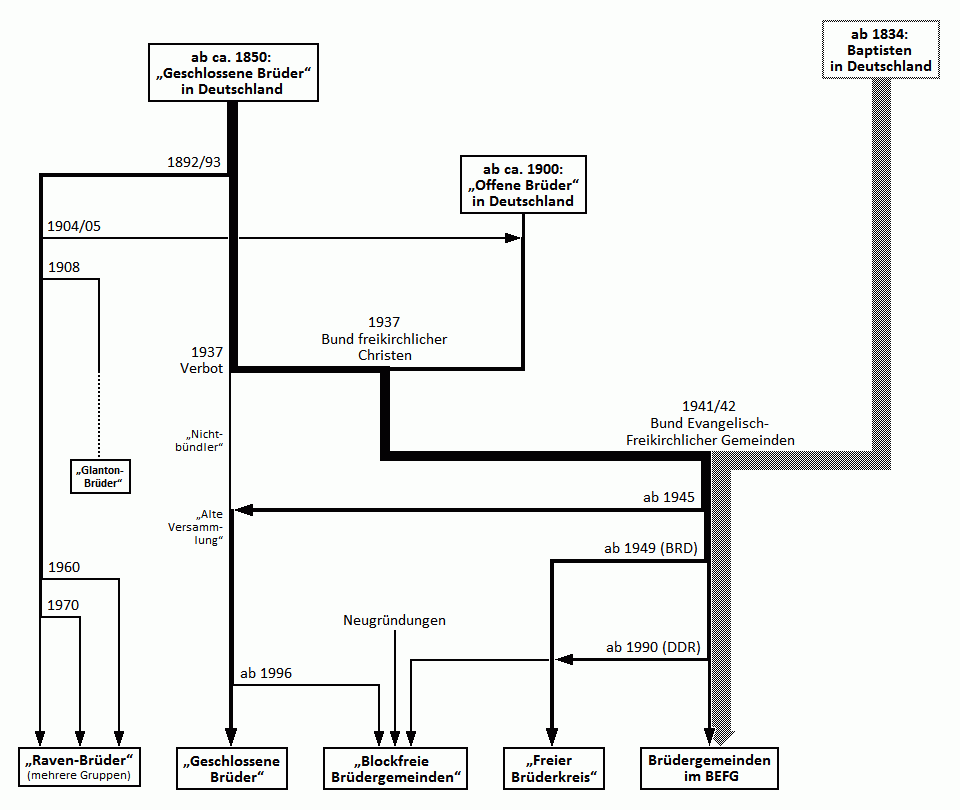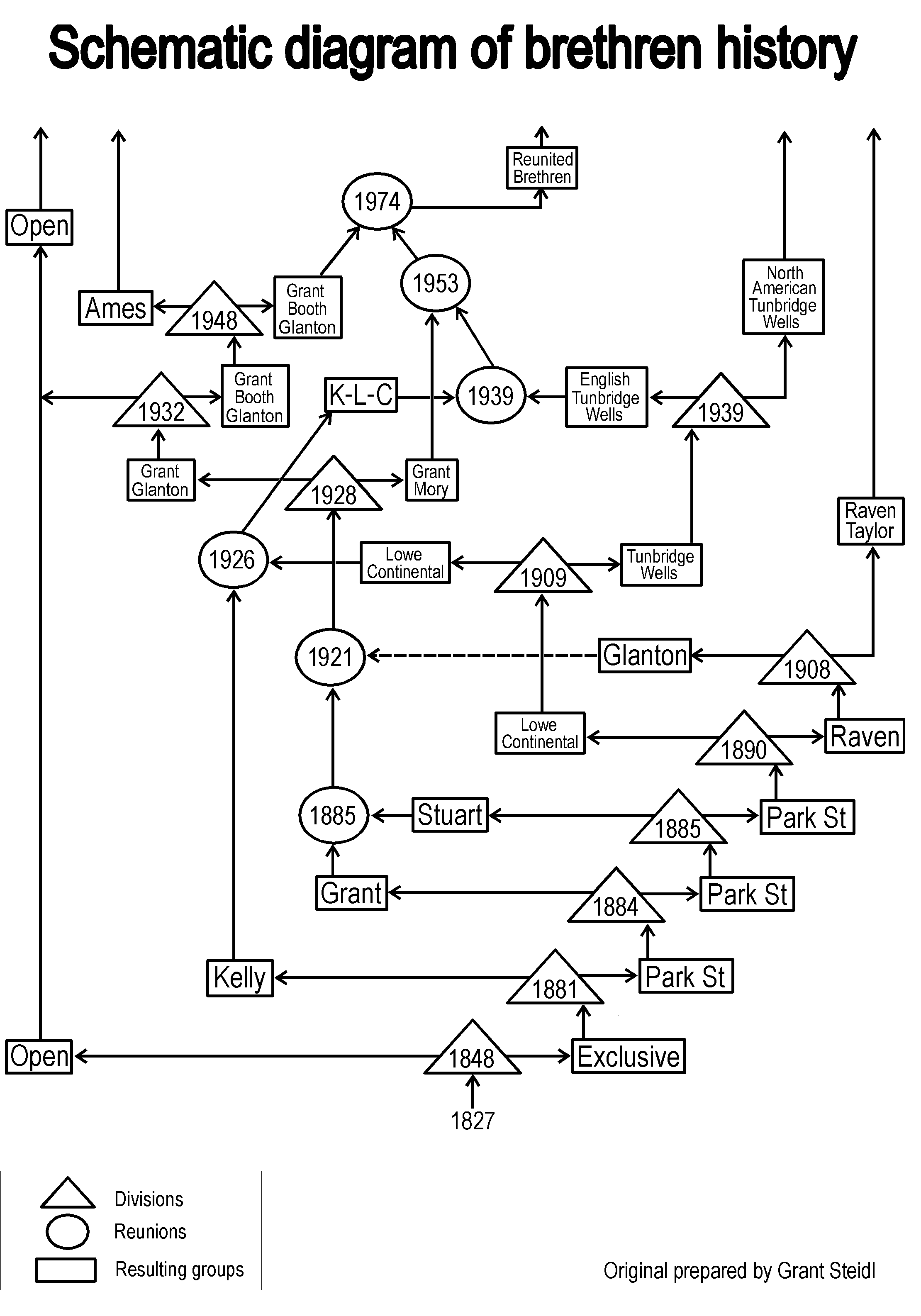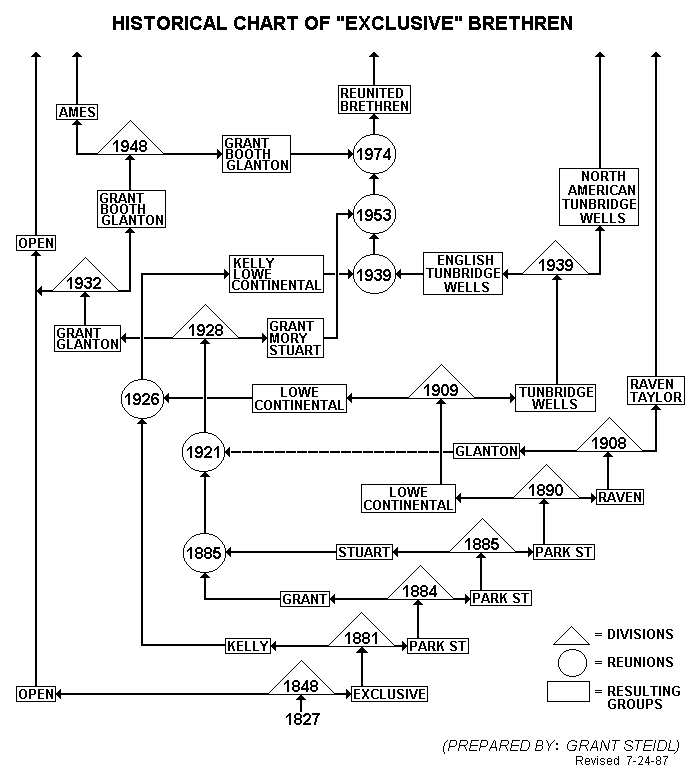Es hat in den letzten Jahren einige Versuche gegeben, zu definieren, was das Wesen einer Brüdergemeinde ausmacht (z.B. von Gerhard Jordy, Hartwig Schnurr, Stephan Holthaus, Karl-Heinz Vanheiden, Philip Nunn). Mir persönlich scheinen dabei äußerliche bzw. organisatorische Merkmale oft zu sehr im Vordergrund zu stehen. Ist wirklich jede Gemeinde, die sich als bibeltreu versteht, keinen Pastor hat, das „allgemeine Priestertum“ praktiziert und jede Woche das Abendmahl feiert, eine Brüdergemeinde? Dann könnte z.B. auch eine Gemeinde, in der die Gültigkeit des mosaischen Gesetzes, die Verlierbarkeit des Heils und der Postmillennialismus gelehrt wird, als Brüdergemeinde durchgehen. Aber wäre das historisch und theologisch gerechtfertigt? Meiner Ansicht nach gehört zur Identität einer Brüdergemeinde unbedingt auch eine dispensationalistische Theologie (und damit meine ich nicht nur eine dispensationalistische Eschatologie, sondern auch eine dispensationalistische Soteriologie und Ethik).
Es hat in den letzten Jahren einige Versuche gegeben, zu definieren, was das Wesen einer Brüdergemeinde ausmacht (z.B. von Gerhard Jordy, Hartwig Schnurr, Stephan Holthaus, Karl-Heinz Vanheiden, Philip Nunn). Mir persönlich scheinen dabei äußerliche bzw. organisatorische Merkmale oft zu sehr im Vordergrund zu stehen. Ist wirklich jede Gemeinde, die sich als bibeltreu versteht, keinen Pastor hat, das „allgemeine Priestertum“ praktiziert und jede Woche das Abendmahl feiert, eine Brüdergemeinde? Dann könnte z.B. auch eine Gemeinde, in der die Gültigkeit des mosaischen Gesetzes, die Verlierbarkeit des Heils und der Postmillennialismus gelehrt wird, als Brüdergemeinde durchgehen. Aber wäre das historisch und theologisch gerechtfertigt? Meiner Ansicht nach gehört zur Identität einer Brüdergemeinde unbedingt auch eine dispensationalistische Theologie (und damit meine ich nicht nur eine dispensationalistische Eschatologie, sondern auch eine dispensationalistische Soteriologie und Ethik).
Ich habe vor einiger Zeit einmal versucht, die (aus meiner Sicht) wichtigsten Merkmale von Brüdergemeinden in knappstmöglicher Form zusammenzustellen, und zwar so, dass sich sowohl „offene“ als auch „geschlossene“ Gemeinden grundsätzlich darin wiederfinden können (abgesehen vielleicht von den äußersten „linken“ und „rechten“ Flügeln).
1. Einfachheit: Brüdergemeinden orientieren sich an den schlichten Gemeindestrukturen des Neuen Testaments. Dazu gehört der Verzicht auf einen besonderen konfessionellen Namen, der sie von anderen Gemeinden mit anderen Namen abgrenzen würde, auf eine formelle Mitgliedschaft, auf hierarchische Organisationsstrukturen u.a.
2. Selbständigkeit und Einheit: Brüdergemeinden sind grundsätzlich selbständig, also keiner überregionalen, nationalen oder internationalen Kirche, Freikirche oder Organisation angeschlossen. Sie pflegen aber freundschaftlichen Kontakt und Austausch mit ähnlich ausgerichteten Gemeinden an anderen Orten und fühlen sich mit allen wiedergeborenen Christen verbunden.
3. Allgemeines Priestertum: Es wird nicht zwischen „Geistlichen“ und „Laien“ unterschieden, sondern jeder Gläubige darf entsprechend den Gaben, die er von Gott erhalten hat, zum Gemeindeleben beitragen. Für keinen der Dienste in der Gemeinde ist eine besondere Ausbildung oder formelle Anstellung erforderlich.
4. Spontaneität: Brüdergemeinden vertrauen darauf, dass der Heilige Geist ihre Zusammenkünfte leitet. Daher wird der Ablauf in der Regel nicht im Voraus geplant, sondern er ergibt sich aus spontanen Gebeten, Liedvorschlägen, Bibellesungen, Wort- und Predigtbeiträgen.
5. Bruderschaftliche Leitung: Eine Gruppe von Brüdern, die sich für die Gemeinde verantwortlich fühlen, übt eine gewisse Leitungsfunktion aus. Sie stehen jedoch nicht über der Gemeinde, sondern mitten in ihr und legen wichtige Entscheidungen der gesamten Gemeinde zur Prüfung vor.
6. Gläubigentaufe: Die Taufe wird als persönlicher Gehorsamsakt nach der Bekehrung verstanden und durch Untertauchen praktiziert. Von Gläubigen, die als Kinder in einer christlichen Kirche getauft wurden und diese Taufe als gültig anerkennen, wird in der Regel keine Wiedertaufe verlangt.
7. Hochschätzung des Abendmahls: Das Abendmahl (Brotbrechen) spielt in Brüdergemeinden eine zentrale Rolle. Es wird nach dem Vorbild des Neuen Testaments jeden Sonntag gefeiert und von Gebeten, Liedern und Schriftlesungen zur Ehre Gottes umrahmt.
8. Offenheit für Besucher: Zu allen Zusammenkünften sind Gäste herzlich willkommen. Am Mahl des Herrn dürfen sie teilnehmen, wenn sie bekennen, dass Jesus Christus ihr Retter und Herr ist und dass sie nicht in einer moralischen oder lehrmäßigen Sünde leben, die nach dem Neuen Testament von der Gemeinschaft ausschließt.
9. Bibeltreue: Die Heilige Schrift gilt als höchste Autorität für Lehre und Leben des Einzelnen und der Gemeinde. Alle Auslegungen, Meinungen und Erfahrungen müssen sich an ihrem Maßstab prüfen lassen.
10. Heilsgeschichtliche Bibelauslegung: Brüdergemeinden sind überzeugt, dass Gott im Laufe der Geschichte auf verschiedene Weise mit den Menschen umgegangen ist. Insbesondere werden das alttestamentliche Volk Israel und die neutestamentliche Gemeinde als unterschiedliche Personengruppen gesehen, für die unterschiedliche Aussagen der Bibel gelten.
11. Stellung und Zustand des Gläubigen: Brüdergemeinden unterscheiden zwischen der vollkommenen, unverlierbaren Stellung des Gläubigen in Christus und seinem oft noch unvollkommenen praktischen Zustand. Das christliche Leben soll durch ständiges Wachstum in der Erkenntnis und der Nachfolge Jesu gekennzeichnet sein.
12. Naherwartung: Brüdergemeinden erwarten die baldige Wiederkunft Jesu Christi zur Auferweckung der verstorbenen und zur Entrückung der lebenden Gläubigen.
 Seit einigen Tagen sind alle 40 Ausgaben des Christian Brethren Research Fellowship Journal (1963–80) bzw. der Christian Brethren Review (1982–89) online zugänglich. In dieser unregelmäßig erschienenen Zeitschrift des „progressiven“ Flügels der englischen Offenen Brüder wurden immer wieder auch interessante Artikel zur Geschichte der Brüderbewegung abgedruckt, z.B.:
Seit einigen Tagen sind alle 40 Ausgaben des Christian Brethren Research Fellowship Journal (1963–80) bzw. der Christian Brethren Review (1982–89) online zugänglich. In dieser unregelmäßig erschienenen Zeitschrift des „progressiven“ Flügels der englischen Offenen Brüder wurden immer wieder auch interessante Artikel zur Geschichte der Brüderbewegung abgedruckt, z.B.: